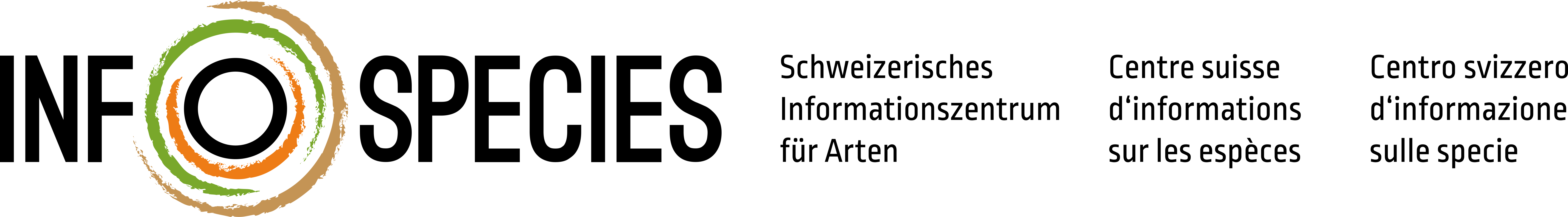Artenförderung
InfoSpecies stellt im Auftrag des Bundesamts für Umwelt BAFU wissenschaftliche Grundlagen bereit für die Umsetzung des Konzepts Artenförderung und für die Erstellung weiterer wichtiger Instrumente für die Erhaltung der Artenvielfalt in der Schweiz. Zudem berät InfoSpecies Bund, Kantone, Gemeinden, NGOs, Pärke und Büros in Fragen zu Synergien und Interessensüberlagerungen in der Artenförderung. Für Fragen zur Förderung von Arten innerhalb einer bestimmten Artgruppe sind die einzelnen nationalen Datenzentren und Koordinationsstellen zuständig.
Konzept Artenförderung
Das Konzept Artenförderung des Bundesamts für Umwelt BAFU definiert Massnahmen, mit denen die Artenvielfalt in der Schweiz erhalten werden soll. Es ist eine wichtige Grundlage für die Umsetzung des Aktionsplans Strategie Biodiversität Schweiz im Bereich Erhaltung der einheimischen Tiere, Pflanzen und Pilze. Im Zentrum steht die spezifische Förderung der prioritären Arten gemäss der Liste der National Prioritären Arten.
National Prioritäre Arten
Die Liste der National Prioritären Arten (NPA-Liste) umfasst jene Pflanzen, Tiere, Pilze und Flechten, welche die Schweiz prioritär erhalten und fördern will. Sie dient als Basis für die Priorisieriung im Artenschutz und wird regelmässig durch InfoSpecies im Auftrag des Bundesamts für Umwelt BAFU aktualisiert. Die Beurteilung wird durch Expertinnen und Experten der Datenzentren und Koordinationsstellen für Artenförderung vorgenommen und erfolgt in Abhängigkeit des Gefährdungsgrads und der internationalen Verantwortung der Schweiz für die einzelnen Arten.
Die NPA-Liste wurde aktualisiert und liegt neu in der Version 2025 vor.
Download Publikation auf der Website des BAFU: Liste der National Prioritären Arten der Schweiz (PDF, 5 MB), Vollzugshilfe BAFU, Stand 2025
Download Anhang mit Artenliste auf der Website des BAFU: Digitale Liste der National Prioritären Arten (XLSX, 1 MB), Stand 2025
Aktionspläne
Nationale Aktionspläne für National Prioritäre Arten: Im Konzept Artenförderung sind zur Förderung der National Prioritären Arten mehrere Aktionspläne vorgesehen, in denen Arten aufgrund von ähnlichen Lebensraumansprüchen gruppiert werden. Der erste dieser Aktionspläne wurde für die Arten des Lichten Walds durch InfoSpecies erarbeitet und ist nun publiziert.
Nationaler Aktionsplan Flusskrebse Schweiz: Dieser Aktionsplan beschreibt die Rahmenbedingungen zur Erhaltung und Förderung der drei einheimischen Krebsarten.
Nationale Aktionspläne Artenförderung Vögel: Für die Umsetzung von Artenförderungsmassnahmen für Vögel wurden im Rahmen des Programm Artenförderung Vögel Schweiz mehrere nationale Aktionspläne mit fachlich fundierten Grundlagen und Umsetzungshilfen erarbeitet.
Informationen zu einzelnen Arten
Informationen und Merkblätter zur Förderung einzelner Arten finden Sie auf den Websiten der Daten- und Informationszentren und der Koordinationsstellen. Die Übersicht finden Sie unter -> Artinformationen.
Rote Listen
Rote Listen sind international anerkannte wissenschaftliche Gutachten, die den Zustand einer taxonomischen Gruppe dokumentieren, den Gefährdungsgrad von Arten darstellen und Hinweise zur Qualität ihrer Lebensräume liefern. Sie werden von Expertinnen und Experten der Datenzentren und der Koordinationsstellen für Artenförderung erarbeitet. Zurzeit verfügt die Schweiz über 21 Rote Listen zu 30 Taxa und eine Rote Liste der gefährdeten Lebensräume.
Die Schweiz hat sich im Rahmen der Biodiversitätskonvention (Aichi Ziel 12) verpflichtet, den Zustand gefährdeter Arten zu dokumentieren und deren Rückgang bis 2020 zu verhindern. Rote Listen werden deshalb im Auftrag des BAFU erstellt und laut Bundesratsbeschluss alle 10 Jahre revidiert. Sie sind ein rechtswirksames Instrument des Natur- und Landschaftsschutzes und gehören zu den Vollzugs- und Arbeitshilfen mit überkantonalem Geltungsbereich («Biotopschutzartikel» NHV Art. 14, Abs. 3d). Rote Listen dienen zudem der Herleitung der Liste der National Prioritären Arten.
Die Publikation Die Roten Listen der IUCN - Erläuterungen zu den Roten Listen der Schweiz (2025, Download PDF) fasst die Prinzipien der Roten Listen der IUCN zusammen und enthält spezifische Erläuterungen zur Anwendung der Kriterien für die Erstellung der Roten Listen der Schweiz. Sie ersetzt den Anhang 1 in den bis 2020 publizierten Roten Listen der Schweiz und ist für alle seit 2021 publizierten Roten Listen gültig.
Liste der Endemiten
In der von InfoSpecies erarbeitete Liste der Endemiten (Stand 2017; pdf; xlsx) werden Arten erfasst, deren bekanntes Verbreitungsareal ausschliesslich auf die Schweiz beschränkt ist (endemisch) oder auf benachbarte Länder übergreift (teilendemisch). Die Kriterien beruhen auf Angaben zur Taxonomie, zum Kenntnisstand und zu den verfügbaren Datengrundlagen sowie auf dem Vorhandensein der Gefährdungseinstufung gemäss Roten Listen. Insgesamt umfasst die Liste 177 Taxa, wovon 39 als für die Schweiz endemisch und 138 als für die Schweiz teilendemisch eingestuft werden.
Fallbeispiele Artenförderung in Biotopen von nationaler Bedeutung
Die Biotope von nationaler Bedeutung sind wichtige Lebensräume für viele national prioritäre Arten (NPA). Für einige dieser Arten sind spezifische Artenförderungsmassnahmen nötig. Die Kantone haben in den letzten Jahren verschiedene Erfahrungen mit solchen Artenförderungsmassnahmen in den Biotopen von nationaler Bedeutung gesammelt. Einige dieser Erfahrungen wurden im Rahmen des Berichtes Artenförderung in Biotopen von nationaler Bedeutung: Zwei Fallbeispiele (10.6.2023, PDF) dokumentiert. Die Evaluation wurde von Info Habitat in Zusammenarbeit mit InfoSpecies durchgeführt.
Nationale Akteure Artenförderung
Bund
Bundesamt für Umwelt BAFU, Abteilung Biodiversität und Landschaft
Bundesamt für Umwelt BAFU, Sektion ökologische Infrastruktur
Bundesamt für Umwelt BAFU, Forum Früherkennung Biodiversität und Landschaft
Kantone
Konferenz der Beauftragten für Natur- und Landschaftsschutz KBNL: Besteht aus LeiterInnen der kantonalen Fachstellen für Natur und Landschaft. Fördert Information, Koordination und fachliche Zusammenarbeit zwischen Kantonen im Bereich Natur & Landschaft. Führt das Projekt Marktplatz für Forschungsfragen.
Konferenz der Kantonsförster KOK: Nationale Konferenz der LeiterInnen der Forstämter oder Waldabteilungen der Kantone und des Fürstentums Liechtenstein. Als Fachkonferenz für den Wald ist sie das beratende Organ der Konferenz für Wald, Wildtiere und Landschaft KWL.
Konferenz für Wald, Wildtiere und Landschaft KWL: interkantonale Konferenz, die sich mit den Politikbereichen Wald und Wildtiere, Lebensräume und Landschaft, mit deren Schutz und deren Nutzung durch Waldwirtschaft, Jagd und Fischerei befasst.
Jagd- und Fischereiverwalter-Konferenz JFK: Nationale Konferenz der kantonalen Fachleute für das Artenmanagement, die Jagd und die Fischerei.
Nationale Koordinationsstellen
Koordinationsstelle Flusskrebse Schweiz: Unterstützt im Auftrag des Bundes die Kantone bei der Umsetzung von Massnamen zum Schutz National Prioritärer Flusskrebs-Arten.
Nationale Biberfachstelle: Beratungs- und Koordinationsstelle für Biberfragen. Informiert und berät im Auftrag des Bundesamts für Umwelt BAFU die Kantone und Gemeinden.
KORA - Koordinationsstelle für Raubtierökologie und Wildtiermanagement: Überwacht im Auftrag des Bundes die Entwicklung der Raubtierpopulationen in der Schweiz, erforscht deren Lebensweise und informiert Behörden, betroffene Kreise und Öffentlichkeit.
Pärke
Netzwerk Pärke: Dachverband aller Pärke und Parkprojekte von nationaler Bedeutung. Die Schweizer Pärke haben einen wichtige Aufgabe in der Artenförderung, indem sie die lokale Wertschätzung der Artenvielfalt fördern und die verantwortlichen Akteure über sektorale Politiken hinweg miteinander vernetzen.
Forschung
Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL: Untersucht den Zustand und die Entwicklung von Wald, Landschaft und Biodiversität sowie die Nutzung und den Schutz der natürlichen Lebensräume und der Kulturlandschaften. Erarbeitet gemeinsam mit der Praxis Wissensgrundlagen, die der Umsetzung von Massnahmen für Artenschutz und –förderung dienen.
EAWAG - Wasserforschungsinstitut des ETH-Bereichs: Erforscht die aquatische Umwelt und kombiniert Erkenntnisse aus der angewandten Forschung und der Grundlagenwissenschaft, um gesellschaftlich relevante Fragen zu untersuchen. Erarbeitet gemeinsam mit der Praxis Wissensgrundlagen, die der Umsetzung von Massnahmen für Artenschutz und –förderung dienen.
Forum Biodiversität Schweiz: Kompetenzzentrum für die Erforschung der Biodiversität in der Schweiz. Fördert den Dialog zwischen Forschung, Verwaltung, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft und bringt für Artenförderung relevantes Wissen aus Praxis und Forschung zusammen.
Swiss Systematics Society SSS: Vereinigt Biologinnen und Biologen, die sich für die Interessen der Systematik und Taxonomie einsetzen. Diese Forschungsgebiete sind die Grundlage der Artenkenntnis – eine wichtige Voraussetzung für Artenförderung.
Naturschutzorganisationen
BirdLife Schweiz: Naturschutzorganisation, die sich von international bis kommunal mit zahlreichen Schutzprojekten aktiv für eine umfassende Sicherung der Naturvorrangflächen einsetzt. Fördert insbesondere Arten, die auf Artenförderungsprogramme angewiesen sind. Partner des Programms Artenförderung Vögel Schweiz.
Pro Natura: Älteste Naturschutzorganisation der Schweiz. Unterhält zahlreiche nationale, kantonale und kommunale Schutzgebiete und fördert auch national prioritäre Arten. Setzt sich aktiv dafür ein, dass geschützte Gebiete an Fläche und Qualität gewinnen und nicht geschützte Gebiete ökologisch wertvoller werden.
Schweizer IUCN Komitee: Besteht aus Mitgliedern von Bund und Naturschutzorganisationen und vertritt die Schweiz bei der internationalen Naturschutzorganisation IUCN. Beherbergt eine institutionsübergreifende Fachgruppe für die Entwicklung und Kommunikation der ökologischen Infrastruktur – eines der Kernanliegen des Aktionsplans Biodiversität Schweiz.